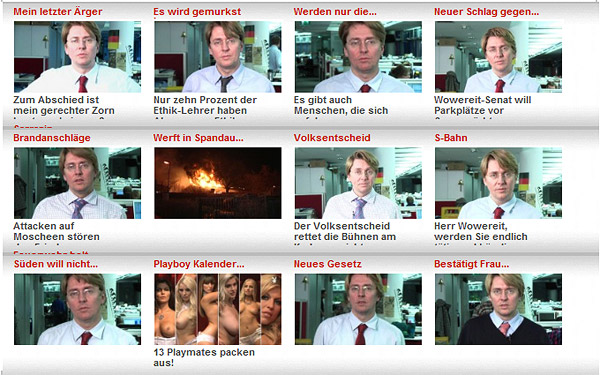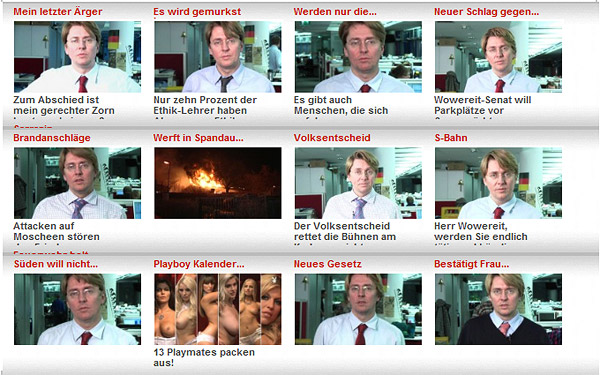
Schupelius und 13 Playmates: So präsentiert die BZ die „Mein-Ärger“-Videos
Letzte Woche haben wir unseren ersten vorläufigen Abschiedsartikel für Gunnar Schupelius online gestellt – und wurden damit sogar im BILDblog erwähnt. Und jetzt ist es tatsächlich schon soweit: Am Freitag verabschiedete sich der BZ-Journalist von seinen Lesern in einer letzten Mein-Ärger-Kolumne.
Milde gibt sich Gunnar Schupelius zum Abschied, der große Ärger scheint verraucht. Genüsslich schwelgt er stattdessen in Erinnerungen (z.B. an rund 40 Kolumnen, die er gegen den Bürgermeister geschrieben habe. Wowereit daraufhin: „Sie wissen, dass Sie niemals ein Interview von mir bekommen?“, Schupelius darauf kess: „Ja, aber wussten Sie, dass ich gar keins haben will?“). Und er spart nicht mit Verweisen auf seine Erfolge: Eine Schutzscheibe zum Schutz vor Übergriffen in BVG-Bussen sei nur dank ihm eingeführt worden, ohne ihn hätte es auch keinen gläsernen Warteunterstand für Botschaftspolizisten gegeben. Fast schon obligatorisch der Dank an die Leser, die ihn mit Briefen und Postkarten immer unterstützt hätten und ihm sicher viele Ärgerthemen überhaupt erst zugeschickt haben.
1331 Kolumnen hat er geschrieben, sagt Schupelius in seinem Abschiedsvideo – er lächelt stolz. Dann eine Kunstpause. Als er die Zahl noch mal nennt, kommt er ins Stocken. Er muss die Zahl noch mal nennen, jetzt lacht er fast. Was für eine Wahnsinnszahl! Drei Jahre Ärger über Sprayer und Taxifahrer, über Gewalttäter und Leute, die aus der Flasche trinken, über Wowereit und über die CDU und natürlich vor allem über die Linken und die Grünen.
Seinen Zorn habe er nicht aus Abneigung auf die Stadt niedergehen lassen – nein, aus Liebe! Und das nimmt man ihm fast ab. Natürlich liebt er nicht ganz Berlin, den Westen etwas mehr als den Osten und die Konservativen mehr als die Linken – klar, aber immerhin.
Wer sich so öffentlich ärgert, kriegt nicht nur Zustimmung. Schenkt man Schupelius Glauben, dann schlägt einem so manches Mal sogar blanker Hass entgegen. „Ich bekam unangenehme Post von Linksradikalen und Graffiti-Schmierern. Damit musste ich leben.“ Kein Wort der Selbstkritik, Schupelius ist immer noch überzeugt von dem was er getan hat.
Mit Gunnar Schupelius verliert die BZ einen ihrer pointiertesten Kommentatoren. Man könnte auch sagen ihren einzigen. Schupelius polarisierte, vertrat abwegige Standpunkte und kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen den Verfall der Hauptstadt.
Liest man seine Kolumnen merkt man schnell: Schupelius fühlt sich unwohl in einer Welt ohne Regeln. Ohne Vorschriften funktioniert das menschliche Zusammenleben in seinen Augen nicht. Linksextreme, Migranten, Grüne sind ihm suspekt, ja unheimlich. Berlin als Stadt ohne Regeln, es ist das große Thema, dass sich durch alle Kolumnen von Schupelius zieht.
Ganz zum Schluss seines Abschiedstextes wünscht er – und das klingt etwas hochgegriffen – seinen Lesern „Gottes Segen“ und prophezeit, dass man sich in „goldenen Zeiten“, vielleicht unter einer „besseren Regierung“ wiedersehen werde. Dann ist er weg.
——————————————————————
Die drei absurdesten Mein-Ärger-Kolumnen:
Weil es so schön ist, zeigen wir zum Abschied noch einmal die schönsten Stücke von Schupelius. Im letzten Artikel haben wir die sechs lustigsten Videos gezeigt, jetzt legen wir noch drei Mal richtig absurden „Ärger“ oben drauf:
1. Wen meinen wir, wenn wir von Migranten sprechen?

Schupelius fragt sich: „Warum nennen wir Kinder, die in Berlin geboren sind, eigentlich ‚Migranten‘ “? Und kombiniert blitzgescheit: „Migrant heißt ‚Wanderer‘“. Doch diese Kinder sind keine Wanderer. Deshalb sei der Begriff falsch. Tja, schön dass die BZ es auch mal merkt – alle anderen verwenden schon längst das Wort „Migrationshintergrund“.
Nach dem Patzer leitet Schupelius ungeschickt auf Muslime über: 90 Prozent der Muslime würden sich als religiös bezeichnen. Das ist Schupelius nicht geheuer. Er weist auf religiöse Unrechtsregime hin – wollen die Muslime in Berlin das etwa auch? Er räumt ein: „Ich weiß es nicht, es würde mich aber interessieren“. Zum Schluß gibt er sich weltläufig: „Von mir aus können alle Menschen in Berlin leben, […] unter einer Bedingung, dass sie unsere Gesetze anerkennen, allen voran unser Grundgesetz.“ Das hat gesessen: Mal wieder um Kopf und Kragen gequasselt.
2. Die Straße vor dem Kanzleramt

Der gerechte Zorn des Gunnar Schupelius kann jeden treffen. Niemand ist sicher: Nicht die CDU, nicht das KaDeWe und nein, nicht einmal die Straße vor dem Kanzleramt.
Das wird jetzt etwas ermüdend, aber die ganze kafkaeske Auto-Odyssee von Schupelius wird nur im Wortlaut wirklich deutlich: „Wenn ich am Kanzleramt vorbei nach Moabit fahren will, muss ich Slalom fahren. Denn die Willy Brandt Straße direkt vor Frau Merkels Dienstsitz ist gesperrt. Also muss ich scharf rechts in die Paul-Löbe-Allee einbiegen, dann links in eine namenlose Teerpiste, dann noch einmal links in die Otto-von-Bismarck-Allee und wieder rechts in die Willy-Brandt-Straße.“
Vielen wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass sie dreimal abgebogen sind. Schupelius aber hat aufgepasst. Gleich nach der Rückkehr in die Redaktion recherchiert er, warum die Straße vor dem Kanzleramt gesperrt ist. „Im Paul-Löbe-Haus haben Bundestagsabgeordnete ihre Büros. Sie sagten, der Verkehr vor ihrer Haustür würde sie stören und sei zu laut.“ Schupelius kann es kaum fassen, Sicherheitsbedenken der Kanzlerin, die kann er akzeptieren. Aber das Bundestagsabgeordnete eine Straße dicht machen, das geht nicht. Das ist frech. Sie müssten den Verkehrslärm aushalten, schließlich sei man nicht im „Sanatorium“! Um seinen Punkt zu unterstreichen, greift Schupelius noch mal weit in die CDU-Geschichte zurück und behauptet: Konrad Adenauer, nach dem diese Straße benannt ist, hätte das bestimmt nicht gewollt. Wir bezweifeln, dass es Adenauer überhaupt interessiert hätte.
3. Aufhebung des Sargzwangs für Muslime

Sollte der Sargzwang für Muslime aufgehoben werden? Wer hat sich das nicht immer schon mal gefragt? Schupelius referiert gekonnt die Tücken des deutschen Bestattungswesens und kommt dann auf den Punkt: Wenn Aufhebung, dann nur wenn Christen auch sarglos unter die Erde kommen dürfen. Weil in Berlin ohnehin kaum noch jemand an Gott glaube, sei das keine so schlechte Sache, wie vielleicht zunächst angenommen. Den Vorwurf, Muslime würden durch den Sargzwang diskriminiert, lässt Schupelius nicht gelten: „Im übrigen werden solche Themen auch meist von kleinen Interessengruppen vorgetragen, von muslimischen Kleingruppen, die nur winzige Teile der muslimischen Bevölkerung repräsentieren“. Bevor er es sich mit allen Religionen verscherzt, leitet Schupelius schnell auf ein anderes Problemthema um: Burkinis im Schwimmbad. Geschickt, geschickt! Kleine Zusatzaufgabe: Zählt mal mit, wie oft Schupelius im Podcast das Wort „Sargzwang“ verwendet.
PS: Das ging schnell. Die BZ hat die Mein-Ärger-Kolumne komplett von ihrer Online-Seite genommen und wirbt an der Stelle nun für ihre frischgebackene Facebook-Fanseite. Wir wollen hoffen, dass das nicht der einzige Ersatz für Schupelius wird…
Danke an Laurence Thio für die gemeinsame Arbeit an diesem Artikel.